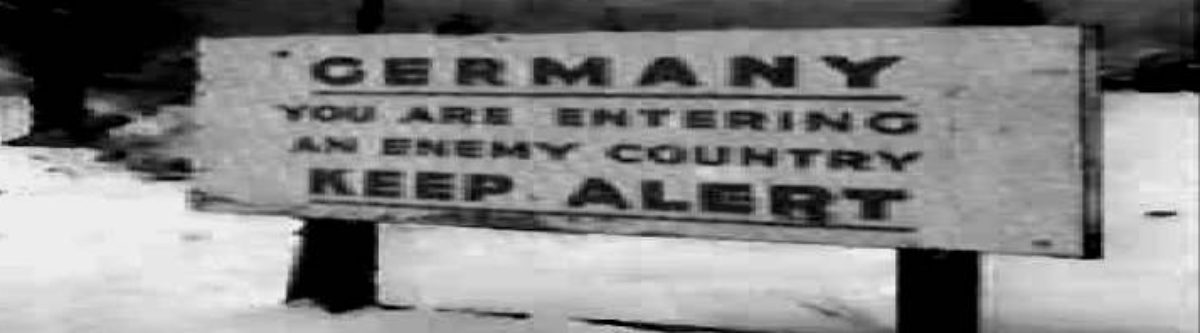Die Debatte um den Familiennachzug ist kein neues Kapitel in der österreichischen Integrationspolitik, aber eines, das zunehmend an Brisanz gewinnt. Aktuelle Medienberichte – unter anderem von exxpress.at – zeichnen ein deutliches Bild: Allein im Jahr 2024 kamen knapp 8.000 Menschen über den Familiennachzug nach Österreich, 2023 waren es über 10.000. Der überwiegende Teil stammt aus Syrien, ein Land, das sich seit Jahren in einem fragilen Wiederaufbauprozess befindet. Die Humanität, die Österreich in der Aufnahme dieser Menschen zeigt, ist zweifellos beachtlich – doch sie hat längst eine systemische Grenze erreicht.
Ein „Stopp“ der keiner ist
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kündigte Mitte März 2025 groß an, den Familiennachzug „zu stoppen“. Was sich nach einer Wende in der Migrationspolitik anhörte, entpuppte sich schnell als eine Formulierung mit Hintertür. In Wahrheit handelt es sich maximal um eine „Hemmung“, nicht um einen tatsächlichen Stopp. Ausnahmen sind vorgesehen – und diese Ausnahmen könnten weiterhin in großer Zahl greifen. Für Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst (FPÖ) ein „Mogelpaket“. Und sie hat vollkommen recht. Wer in Österreich Asyl erhält, kann nach wie vor relativ schnell seine Familie nachholen – mit staatlich definierter Drei-Monats-Frist für den Antrag. Subsidiär Schutzberechtigte müssen zwar drei Jahre warten, doch auch sie haben letztlich Anspruch.
Die Realität in den Schulen und Spitälern
Die Zahlen sind alarmierend – nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Alltag der Menschen in Österreich. 34 Prozent der Pflichtschüler sprechen nicht Deutsch als Alltagssprache, in manchen Wiener Bezirken ist diese Zahl weitaus höher. Lehrer berichten seit Jahren von Überforderung, Schulpsychologen schlagen Alarm, und Eltern wünschen sich eine Rückkehr zu einem System, in dem Integration mehr bedeutet als reine Anwesenheit – und die Zugewanderten auch in die Pflicht nimmt.
Auch das Gesundheitssystem ächzt. Terminwartezeiten werden länger, Sprachbarrieren führen zu Fehlkommunikation, medizinisches Personal ist unterbesetzt – eine Entwicklung, die zwar nicht allein durch den Familiennachzug verursacht, aber durch ihn und die Migration im Allgemeinen deutlich mitverschärft wird.
Ein solidarischer Staat – aber wie lange noch?
Zweifelsohne ist Österreich ein Land mit humanitärem Anspruch, das sich zu internationalem Schutzrecht und europäischen Werten bekennt. Doch Humanität ohne klare Grenzen ist kein Zukunftsmodell. Es braucht eine ehrliche Diskussion darüber, wie viele Menschen das Sozialsystem tatsächlich tragen kann, ohne an Substanz zu verlieren – insbesondere dann, wenn diese Menschen jahrelang von staatlicher Grundversorgung abhängig bleiben.
Erschwerend kommt hinzu: Die tatsächlichen Kosten des Familiennachzugs sind nicht öffentlich einsehbar. Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung an die FPÖ sind diese „nicht eruierbar“. Das ist intransparent und politisch brandgefährlich – es schafft Raum für Spekulation, Angst und Polarisierung.
Integration beginnt nicht mit Einreise
Eines der größten Missverständnisse in der aktuellen Migrationspolitik ist die Annahme, Integration beginne automatisch mit dem Grenzübertritt. In Wahrheit beginnt sie mit Bildung, Spracherwerb, Arbeit – und mit dem Willen zur aktiven Teilhabe. Viele der Menschen, die über den Familiennachzug nach Österreich kommen, sind Analphabeten in ihrer Muttersprache, verfügen über keinerlei Ausbildung und sprechen kein Deutsch. Das ist kein Populismus, sondern eine nüchterne Feststellung – eine, die politischen Realismus erfordert statt gut gemeinter Illusion.
Was jetzt zu tun wäre
Die Politik muss den Mut aufbringen, den Familiennachzug tatsächlich zu reformieren. Das bedeutet: klare Kriterien, transparente Obergrenzen, verpflichtende Integrationsvereinbarungen schon vor der Einreise. Es braucht nicht zuletzt auch eine ehrliche Bilanzierung der Kosten – nicht als Angstmache, sondern als demokratische Pflicht gegenüber dem Steuerzahler.
Und es braucht die offene Diskussion über die längst überfällige Möglichkeit der Rückführung für nicht integrierbare Migranten.
Eine Gesellschaft, die ihre Belastungsgrenzen ignoriert, riskiert nicht nur sozialen Frieden – sie gefährdet auch die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats und der Demokratie.
Einreiserecht ohne Integration? Familiennachzug auf dem Prüfstand – UnserTirol24